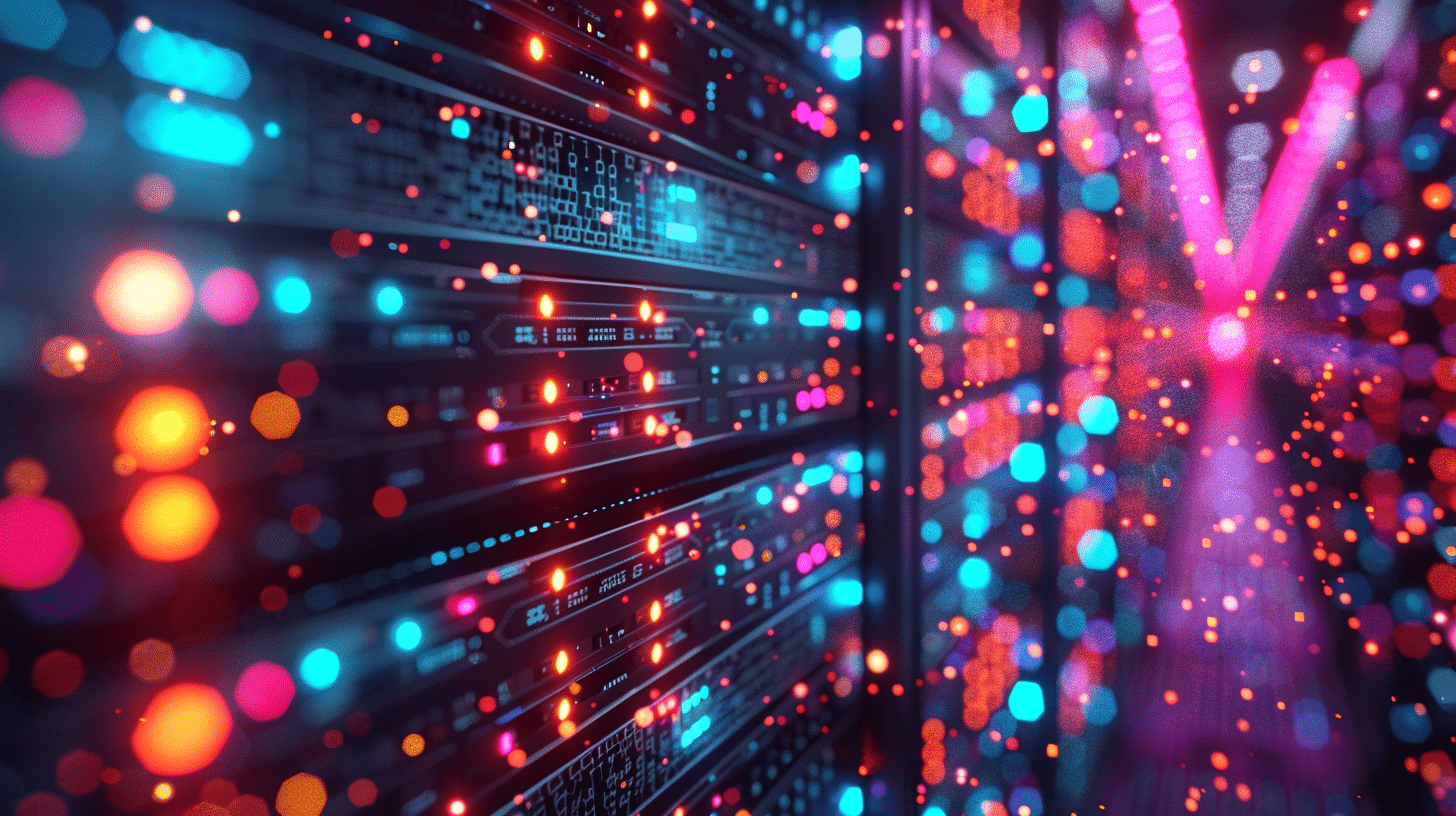Warum sind digitale Zwillinge für den Finanzsektor relevant?
Steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Systemkomplexität und die zunehmende Dynamik globaler Märkte stellen Finanzinstitute vor tiefgreifende Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck, datengetriebene Entscheidungen schneller, transparenter und robuster zu treffen.
In diesem Spannungsfeld rücken digitale Zwillinge in den Fokus: Was einst in der Industrie seinen Ursprung hatte, entwickelt sich nun auch im Finanzsektor zu einem leistungsstarken Instrument strategischer Transformation.
Was ist ein digitaler Zwilling?
Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts, Systems, Prozesses oder eines gesamten Unternehmensbereichs. Anders als ein statisches Modell ist der digitale Zwilling dynamisch: Er wird fortlaufend mit Echtzeitdaten gespeist, um das Verhalten und den Zustand seines realen Gegenstücks möglichst präzise abzubilden.
In der Regel setzt sich ein digitaler Zwilling aus mehreren Komponenten zusammen:
- Der digitale Master bildet ein strukturelles Referenzmodell. Er beschreibt, wie ein Objekt oder Prozess grundsätzlich funktionieren soll – etwa die Sollkonfiguration bzw. das erwartete Verhalten eines IT-Systems oder die erwartete Kundenreise in einer Bank.
- Der digitale Schatten spiegelt mithilfe von Echtzeitdaten die reale Welt, zum Beispiel Transaktionsdaten, Systemkennzahlen wie Serverauslastung, Netzwerklast oder Fehlerstatus, Nutzerverhalten sowie externe Einflussgrößen wie Marktbedingungen oder regulatorische Ereignisse. Auf Basis dieser Daten entsteht ein realitätsnahes digitales Abbild.
- Durch die Verknüpfung des digitalen Masters mit dem digitalen Schatten wird das Potenzial des digitalen Zwillings erschlossen. Mithilfe von Algorithmen, maschinellem Lernen oder regelbasierten Systemen wird der digitale Master mit dem digitalen Schatten abgeglichen, um Prognosen und Optimierungen durchzuführen.
Wird der digitale Zwilling in ein größeres System eingebettet, können ganze Wertschöpfungsketten, Organisationen oder Netzwerke virtuell abgebildet und gesteuert werden. Die zentrale Idee: Entscheidungen werden nicht mehr auf Grundlage historischer Berichte getroffen, sondern basieren auf Echtzeitinformationen und simulierten Zukunftsszenarien.
BankingHub-Newsletter
„(erforderlich)“ zeigt erforderliche Felder an
Welche Anwendungsfälle gibt es in der Finanzindustrie?
Netzwerkinfrastruktur und IT-Betrieb
Digitale Zwillinge bieten im IT-Betrieb von Finanzinstituten einen leistungsstarken Ansatz zur Visualisierung, Steuerung und Optimierung komplexer Infrastrukturen. Durch ein dynamisches, digitalisiertes Abbild der gesamten Systemlandschaft – einschließlich Servern, Anwendungen, Netzwerktopologie, Sicherheitszonen und Cloud-Komponenten – lassen sich technische Abhängigkeiten transparent darstellen, Veränderungen simulieren und Störungen frühzeitig erkennen.
Anwendungsfall: Vor einer größeren Cloud-Migration nutzt eine Bank einen digitalen Zwilling ihrer bestehenden hybriden Infrastruktur. Dabei wird simuliert, wie sich das Verschieben geschäftskritischer Anwendungen in die Cloud auf Latenzzeiten, die Schnittstellenverfügbarkeit, Datenflüsse und regulatorische Anforderungen auswirkt. Auch Ausfallszenarien und Sicherheitsimplikationen können modelliert werden, bevor reale Änderungen erfolgen.
Operationelle Risiken und Resilienz
Digitale Zwillinge sind relevant im Kontext der Identifikation und Steuerung operationeller Risiken. Dazu zählen unter anderem IT-Ausfälle, menschliches Versagen, Prozessbrüche oder externe Störungen wie Cyberangriffe. Digitale Zwillinge ermöglichen es, kritische Infrastrukturen, Geschäftsprozesse oder Netzwerktopologien digital abzubilden und auf Störanfälligkeit zu analysieren. Durch die Simulation von Ausfällen, Angriffsszenarien oder Prozessabweichungen können Schwachstellen frühzeitig erkannt, Notfallpläne getestet und präventive Maßnahmen abgeleitet werden – noch bevor reale Schäden eintreten.
Anwendungsfall: Ein Zahlungsdienstleister nutzt einen digitalen Zwilling seiner End-to-End-Zahlungsabwicklung, um die Auswirkungen von Prozessunterbrechungen – etwa durch einen Ausfall externer Clearingpartner – zu simulieren. Anhand des Modells lassen sich alternative Routen, Zeitverzögerungen und potenzielle Auswirkungen auf die Liquidität, Kundenkommunikation und regulatorische Meldepflichten analysieren. Die Simulation hilft, kritische Abhängigkeiten zu identifizieren und Resilienzmaßnahmen – wie Failover-Strategien und die automatisierte Eskalation – gezielt zu priorisieren.
Kundenzentrierung
Digitale Zwillinge lassen sich nicht nur auf Prozesse und Infrastrukturen anwenden, sondern auch auf Kundenbeziehungen. Banken können mithilfe sogenannter „Customer Digital Twins“ das Verhalten, die Bedürfnisse und die Lebenssituationen ihrer Kunden besser verstehen und antizipieren. Dazu werden verschiedene Datenquellen wie Transaktionshistorie, Produktnutzung, Kommunikationsverhalten oder Standortinformationen in einem virtuellen Abbild zusammengeführt – ergänzt um externe Signale wie makroökonomische Trends oder Veränderungen im sozialen Umfeld.
Anwendungsfall: Ein digitaler Kundenzwilling erkennt auf Basis von wiederkehrenden Kontoabhebungen, Kreditkartenzahlungen im Baumarkt und dem Browsing-Verhalten im Onlinebanking-Portal ein erhöhtes Interesse an Immobilien. Noch bevor der Kunde aktiv nach Finanzierungslösungen fragt, kann das System ein passendes Hypothekenangebot generieren – abgestimmt auf dessen Bonität, regionale Marktdaten und persönliche Präferenzen. So entsteht ein proaktives, datenbasiertes Kundenerlebnis mit hoher Relevanz und Effizienz.
Portfoliosimulation und Investmentstrategie
In der Finanzwelt sind Simulationstechniken wie Monte-Carlo-Analysen oder Value-at-Risk-Modelle seit Langem etabliert. Digitale Zwillinge ermöglichen es jedoch, diese Methoden in Echtzeit und mit deutlich höherer Kontexttiefe weiterzuentwickeln. Durch die Integration von Marktdaten, ESG-Kriterien, geopolitischen Entwicklungen oder makroökonomischen Indikatoren können Fondsmanager:innen ihre Strategien kontinuierlich überwachen, validieren und anpassen.
Anwendungsfall: Ein Vermögensverwalter bildet ein Multi-Asset-Portfolio digital ab und integriert ESG-Ratings, CO₂-Fußabdrücke und regulatorische Vorgaben aus der EU-Taxonomie. Das System simuliert, wie sich neue Umweltverordnungen, Lieferkettenrisiken oder die CO₂-Bepreisung auf die Performance und das Risikoprofil des Portfolios auswirken. Auf Basis dieser Analysen kann das Portfoliomanagement frühzeitig Umschichtungen vornehmen oder Anlageentscheidungen auf Grundlage regulatorischer Trends treffen.
Smart Finance Ecosystems
Mit der Öffnung von Finanzsystemen im Zuge von Open Banking, Embedded Finance und Plattformmodellen werden Finanzdienstleistungen zunehmend vernetzt, modular und dynamisch. Digitale Zwillinge bieten hier einen neuen Ansatz, um ganze Wertschöpfungsketten modellhaft abzubilden – inklusive der beteiligten Banken, FinTechs, Versicherer, Plattformanbieter und ihrer jeweiligen Schnittstellen. Die digitalen Abbilder solcher Ökosysteme ermöglichen es, Datenflüsse, Interaktionen und Prozessketten zu simulieren – etwa zur Optimierung von Schnittstellenarchitekturen, Testung regulatorischer Anforderungen oder Überwachung von Abhängigkeiten zwischen Partnern.
Anwendungsfall: Bevor eine Bank eine neue API-Schnittstelle zu einem Zahlungsdienstleister liveschaltet, nutzt sie ein digitales Abbild des gesamten Transaktionsprozesses. Darin werden Echtzeitdatenströme, Authentifizierungslogiken und mögliche Ausfallszenarien simuliert. Die Bank kann prüfen, wie sich Lastspitzen, Time-out-Risiken oder fehlerhafte Partnerantworten auf die Endkundenerfahrung auswirken – und die Integration entsprechend anpassen, bevor reale Kunden betroffen sind.
Software-as-a-Service (SaaS) bietet entscheidende Vorteile
Welche technologischen Faktoren treiben die Entwicklung digitaler Zwillinge voran?
Die Entwicklung und Anwendung digitaler Zwillinge in der Finanzbranche basiert auf dem Zusammenspiel mehrerer Schlüsseltechnologien. Diese ermöglichen nicht nur die technische Umsetzung, sondern bestimmen maßgeblich, wie skalierbar, effizient und intelligent digitale Zwillinge eingesetzt werden können.
- Künstliche Intelligenz (KI): KI-Algorithmen erkennen Muster, erstellen Vorhersagen und optimieren Entscheidungen – auf Basis historischer wie auch aktueller Echtzeitdaten. In digitalen Zwillingen fungiert KI als Analyse- und Steuerungsschicht, die Simulationen in adaptive Handlungsempfehlungen übersetzt.
- Internet of Things (IoT): Während IoT in der Industrie meist mit physischen Sensoren verbunden ist, erzeugen in der Finanzwelt vor allem digitale Kontaktpunkte die relevanten Datenströme: etwa Transaktionen an Geldautomaten, Kundeninteraktionen in Filialen, Netzwerkzugriffe in Rechenzentren oder Systemmeldungen aus Zahlungssystemen. Diese Echtzeitinformationen speisen kontinuierlich das Datenmodell des digitalen Zwillings.
- Cloud- und Edge-Computing: Die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen erlaubt es, komplexe Simulationsmodelle flexibel zu betreiben und große Datenmengen performant zu verarbeiten. Edge-Computing wiederum ermöglicht die Vorverarbeitung und Analyse nahe an der Datenquelle – beispielsweise im Zahlungsverkehr oder an dezentralen Standorten.
- Daten- und Prozessvisualisierung: Anders als in der Industrie, wo häufig mit 3D-Modellen gearbeitet wird, setzen Finanzinstitute auf interaktive Dashboards, Prozess-Mining-Tools und Netzwerkdiagramme. Diese Visualisierungen übersetzen komplexe Systemzustände in intuitiv erfassbare Entscheidungsgrundlagen – nicht nur für Analyst:innen, sondern auch für Führungskräfte und Risiko-Owner.
Wo liegen die Herausforderungen bei der Einführung digitaler Zwillinge?
Trotz des hohen strategischen Potenzials stehen viele Finanzinstitute bei der Einführung digitaler Zwillinge vor strukturellen, technischen und kulturellen Hürden:
- Realitätsnähe: Ein funktionierender digitaler Zwilling ist auf kontinuierliche Echtzeitdaten und eine Umgebung angewiesen, die der produktiven Systemlandschaft möglichst genau entspricht. Das stellt hohe Anforderungen an die Infrastruktur, Schnittstellen, Zugriffsrechte und die Rechenleistung. In der Praxis müssen oft parallele Architekturen aufgebaut werden – inklusive aller sicherheitsrelevanten und regulatorischen Vorgaben. Dieser „doppelte Betrieb“ verursacht nicht nur Aufwand und Kosten, sondern setzt auch ein hohes Maß an Systemintegration und Governance voraus, um die digitale Kopie verlässlich am Leben zu halten.
- Datensicherheit und regulatorische Anforderungen: Der Umgang mit hochsensiblen Finanz- und Kundendaten erfordert maximale Sicherheitsstandards und die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorgaben – etwa der DSGVO in der EU oder spezifischer Aufsichtsregeln wie der Bestimmungen der FINMA in der Schweiz. Auch die Transparenz von Modellen und Algorithmen rückt stärker in den regulatorischen Fokus.
- Komplexität der Modellierung: Die Wirksamkeit digitaler Zwillinge hängt entscheidend von der Qualität, Aktualität und Vernetzbarkeit der zugrunde liegenden Daten ab. In der Praxis scheitern viele Projekte an mangelnder Datenverfügbarkeit oder ungenauen Modellierungsansätzen.
- Organisatorischer Wandel: Digitale Zwillinge erfordern nicht nur Technologie, sondern auch neue Rollenprofile, Prozesse und ein datenbasiertes Mindset. Ohne aktives Change-Management und bereichsübergreifende Verantwortung bleiben viele Initiativen wirkungslos.
- Mangel an interdisziplinärem Fachwissen: Der Aufbau und Betrieb digitaler Zwillinge verlangt Know-how an der Schnittstelle von IT, Datenanalyse, Finanzmathematik und operativen Prozessen.
Ausblick: Welche Erfolgsfaktoren sind für die Umsetzung entscheidend?
Digitale Zwillinge entwickeln sich zunehmend zu einem strategischen Instrument für datengetriebene Entscheidungsfindung in der Finanzindustrie. Ihr größter Nutzen liegt in der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge dynamisch zu simulieren, Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien vorherzusagen und Optimierungen in Echtzeit umzusetzen – basierend auf kontinuierlich aktualisierten Datenmodellen. So entsteht die Grundlage für eine „lernende Organisation“, die flexibel auf interne wie externe Veränderungen reagieren kann.
Die zentrale Herausforderung bleibt: Wie gelingt die erfolgreiche Umsetzung? Hier leisten Unternehmensberatungen mit Fokus auf Business Technology einen entscheidenden Beitrag – als Bindeglied zwischen strategischer Vision, technologischem Know-how und regulatorischer Absicherung.
Sie unterstützen u. a. durch:
- Strategieentwicklung: Identifikation relevanter Anwendungsfelder und Ausarbeitung tragfähiger Roadmaps
- Technologie- und Plattformwahl: Auswahl geeigneter Tools für Simulation, Analyse und Visualisierung
- Datenarchitektur und Governance: Aufbau skalierbarer Datenmodelle, Schnittstellen und Kontrollmechanismen
- Change-Management: Schulung, kulturelle Verankerung und Befähigung der Organisation
- Regulatorische Absicherung: Berücksichtigung von Datenschutz, IT-Sicherheit und prüfbarer Modellnutzung
Damit werden Beratungsunternehmen zu Wegbereitern einer Transformation, bei der der digitale Zwilling nicht als technisches Projekt endet – sondern als nachhaltiges Wertschöpfungskonzept in den Kern der Finanzorganisation überführt wird.
Digitale Zwillinge sind weit mehr als digitale Abbilder …
… Sie entwickeln sich zu strategischen Steuerungsinstrumenten für Effizienz, Innovation und Resilienz. In einer Branche, die von Komplexität, Regulierung und hohem Veränderungsdruck geprägt ist, bieten sie Finanzinstituten die Chance, Risiken vorausschauend zu managen, Kundenbedürfnisse präziser zu bedienen und operative Prozesse kontinuierlich zu optimieren.
Wer frühzeitig in die richtige Kombination aus Technologie, Architektur und Datenkompetenz investiert, gestaltet die nächste Stufe der digitalen Transformation aktiv mit. Entscheidend wird sein, die Balance zwischen Innovationskraft und regulatorischer Konformität zu wahren – nur dann können digitale Zwillinge ihr volles Potenzial entfalten und zum unsichtbaren Gamechanger der Finanzwelt werden.